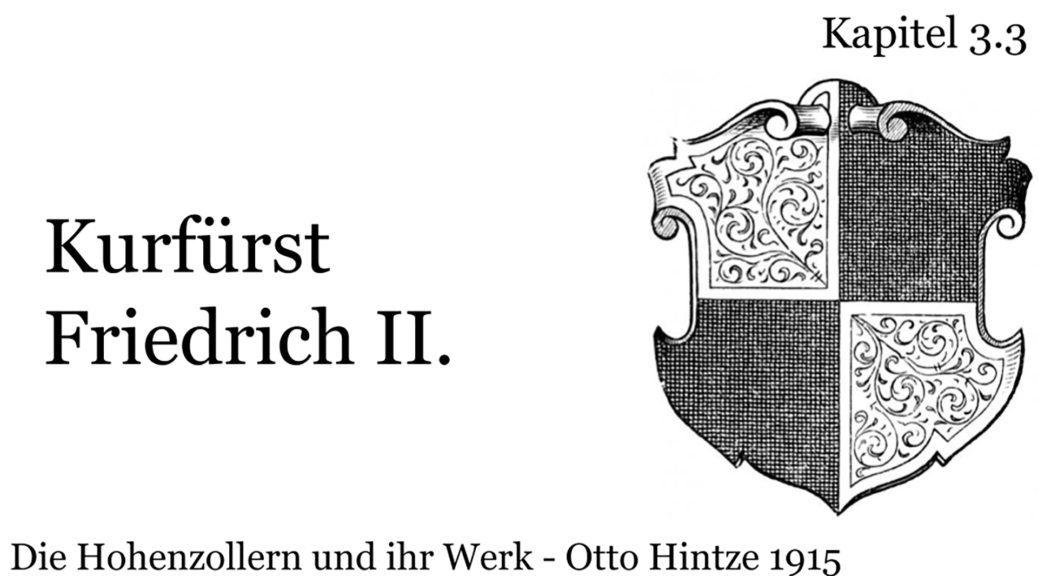
3.3 Friedrich II.
Die beiden Brüder, die hauptsächlich als die Regenten der Mark und der fränkischen Lande in Betracht kommen, waren von sehr ungleicher Gemütsart und von ganz verschiedener politischer Richtung, trotzdem aber haben sie, wenn auch ihre Interessen nicht in allen Einzelheiten zusammengingen, doch im Großen und Ganzen stets brüderlich zusammengehalten und so, sich gegenseitig ergänzend, eine gemeinsame Hauspolitik getrieben, die dem Ansehen des Hauses zugutegekommen ist. Friedrich II., der ältere von beiden, war eine schlichte, gediegene Natur von starkem Innenleben, aber nicht eben glänzend und eindrucksvoll in seinem äußeren Auftreten; er wusste und hat es oft gesagt, dass er kein Kriegsmann und Feldherr sei; aber er war ein Staatsmann mit vorzüglichen Regenteneigenschaften, wenn auch — oder vielleicht gerade weil — der Aktionsradius seiner Politik nicht so weit reichte wie der seines glänzenderen und unternehmungs-lustigeren Bruders. Er war ein märkischer Landesfürst und wollte nichts anderes sein. In der Beschränkung auf diese Aufgabe aber hat er sich als Meister gezeigt. Die Stetigkeit und zähe Konsequenz, die er dabei bewies und die seinem Bruder fehlte, hat ihm bei späteren Schriftstellern den Beinamen des „Eisernen“, „des Eisenzahns“ eingetragen, zu dem die ursprüngliche Weichheit seines Gemüts in einem bemerkenswerten Gegensatze steht. Er war, wie schon erwähnt, mit 8 Jahren an den polnischen Hof gekommen, wo er als künftiger Thronfolger und Verlobter der auch noch im kindlichen Alter stehenden Prinzessin Hedwig erzogen wurde. Als dann dem alternden König Wladislaw von seiner vierten Gemahlin, Sophie von Kiew, noch drei Söhne geboren wurden und damit die Aussichten des brandenburgischen Prinzen auf die Thronfolge schwanden, da hatte der Knabe unter dem unfreundlichen Regiment der Stiefmutter Hedwigs böse Tage an dem fremden Hofe, wo er noch aushalten musste, bis in seinem 18. Jahre der plötzliche Tod seiner Verlobten das Verhältnis löste. Er widmete ihr über das Grab hinaus eine schwärmerische Neigung, und wie Dantes Beatrice hat die Gestalt der Frühvollendeten noch in viel späteren Jahren als ein verklärter Schutzgeist ihm vor Augen gestanden. Eine melancholische Grundstimmung beherrscht von den Tagen dieser trüben Kindheit und Jugend her sein Gemütsleben; und in Verbindung damit eine tiefe und innige Religiosität, die sich nicht nur in guten Werken nach dem Herzen der Kirche äußerte. Er hat Kirchen und Klöster gegründet; er ist 1453 zum Heiligen Grabe gewallfahrt. Freilich war das damals eine Modesache geworden; auch seine Brüder Johann und Albrecht haben eine solche Wallfahrt unternommen, wobei der jüngere Bruder von dem älteren in der Grabeskirche zu mitternächtiger Stunde den Ritterschlag empfangen hat, ohne dass man daraus auf irgendwelche religiöse Schwärmerei bei Albrecht schließen dürfte; aber bei Friedrich hatte das alles einen tieferen Sinn und eine höhere Bedeutung. Vor allem aber war er doch durchdrungen von einem starken Pflichtgefühl gegenüber seinen landesfürstlichen Aufgaben. Er hat sich in der Mark als ein Pionier deutscher Art und Gesittung und als ein Grenzhüter des Reiches gegen die fremde Zunge gefühlt; in mehreren seiner Briefe, namentlich in einem an den Kaiser gerichteten von 1465 kommt das deutlich zum Ausdruck. Es ist ein ungewohnter Ton in jener Zeit; die inneren Erlebnisse während seines Jugendexils am polnischen Hofe werden ihm den Sinn für deutsche Eigenart gestärkt haben. Er hat die ihm einst bestimmt gewesene polnische Krone, als sie ihm nach dem Tode Wladislaws 1444 doch angeboten wurde, abgelehnt; ebenso, nach manchen Bedenken und Erwägungen, 1468 auch die böhmische Krone, zu deren Annahme — im Gegensatz zu dem gebannten Hussitenkönig Georg Podiebrad — damals Papst und Kaiser ihn überreden wollten. Er hat sich mit bewusster Selbstbeschränkung in den Dienst der Aufgabe gestellt, den märkischen Landesstaat auszubauen; den Gesandten des Deutschen Ordens, die ihn in Unterhandlungen einmal darauf hinwiesen, das sein Vater viel weniger zäh und hartnäckig auf seinen Interessen bestanden hätte, hat er die schlagende Antwort gegeben: Mein Vater hatte viele Länder, ich habe nur eins! In der Verfolgung seiner berechtigten Interessen scheute er auch vor Krieg und Gewalt nicht zurück, obwohl er im Grunde seines Herzens ein Mann des Friedens und der Gerechtigkeit war. Nichts ist bezeichnender für seine Art, als die plattdeutschen Worte aus einem seiner Briefe, die unser Kaiser als Devise auf das ihm gewidmete Relief am Losonderschen Portal des Königlichen Schlosses hat setzen lassen: „Iss wol einen jedermann witlik dat wy sind all unnse leve dage na hader edder krige ny bestan gewesst und begern noch hutigen duges nicht anders dann men ere und rechts.“
Zwei große Aufgaben hatte er sich für seine Landesregierung gestellt: die Herstellung der Ordnung und fürstlichen Hoheit im Innern und die Wiedergewinnung der Länder und Landansprüche, die einst zur Kurmark Brandenburg gehört hatten. Dieses Doppelspiel hat er mit Festigkeit und Konsequenz im Auge behalten, solange er regierte; und wenn er nicht alles erreicht hat, was er erstrebte, so war doch der Erfolg im Großen und Ganzen bedeutend.
Das erste, was er abzustellen unternahm, war die wiedereingerissene Selbsthilfe des Adels, das Raub- und Fehdewesen, das wieder begonnen hatte, das Land unsicher zu machen. Es bedurfte nur seiner stärkeren landesherrlichen Hand und seiner beharrlicheren Regentenarbeit, um dies Übel, das unter Johanns schlaffem Regiment gefährlich angeschwollen war, wieder einzudämmen; der Adel wurde wieder daran gewöhnt, seine Lehnspflicht zu leisten und dem Gericht des Landesherrn sich zu unterwerfen, das allmählich wieder zu Kraft und Ansehen gebracht wurde. Im Jahre 1465 konnte Friedrich dem Herzog Heinrich von Mecklenburg versichern, dass man unbehelligt von Räubereien auf den Straßen der Mark reisen könne. Von Bedeutung für diesen Punkt ist namentlich auch die Stiftung des Schwanenordens (1440), die neben der religiösen doch auch eine oft übersehene politische Seite hat. Es ist ein Akt, der nicht vereinzelt in der Geschichte der Zeit dasteht. Kurz vorher (1435) war der berühmte Orden vom Goldenen Vlies durch den Herzog Philipp den Guten in Burgund gestiftet worden nach dem Vorgang Frankreichs, wo König Johann schon 1351 den Ritterorden vom Stern ins Leben gerufen hatte. Der englische Hosenbandorden (gestiftet 1350 von Eduard III.), der schwedische Seraphinenorden, der seit 1336 nachweisbar ist, auch der spätere dänische Elefantenorden, der Orden des Heiligen Michael, den Ludwig XI. von Frankreich 1464 gründete, sind ähnliche Erscheinungen. Bei dem Verfall der alten Lehnskriegsverfassung und dem Aufkommen der neueren monarchischen Staatsordnung versuchten die Fürsten überall, durch solche nach dem Muster der geistlichen Ritterorden eingerichtete Korporationen den Adel, der vielfach geneigt war, aus dem Stegreif zu leben, an christliche und höfische Sitte und Zucht zu gewöhnen und vor allem ihn mit monarchischem Geiste zu erfüllen. Diese Ordenskörperschaften wurden überall der Kern des neuen dem Fürsten ergebenen Hofadels. Der brandenburgische Schwanenorden hat zwar in dieser Hinsicht wie überhaupt keine große und langdauernde Wirkung ausgeübt, aber seine religiös-politische Tendenz ist bezeichnend für die allgemeinen Absichten Friedrichs II.
Stärkeren und weiterreichenden Eindruck machte das erfolgreiche Einschreiten gegen die Selbstherrlichkeit der Städte. Schon bei der Huldigung (1440) hatte Friedrich es abgelehnt, alle ihre Privilegien im Einzelnen zu bestätigen. Als dann im Jahre 1442 der schon lange vorhandene Gegensatz zwischen dem patrizischen Rat der neuen Doppelgemeinde Berlin-Cölln und den vom Regiment ausgeschlossenen, mit der neuen Ordnung der Dinge unzufriedenen Gewerken zu offenem Streit ausbrach und beide Parteien die Entscheidung des Kurfürsten anriefen, da ergriff Friedrich gern die Gelegenheit, um die landesherrliche Hoheit in dieser bedeutendsten Stadt seines Landes zur Geltung zu bringen, deren Rat ihm bisher das Öffnungsrecht nicht hatte zugestehen wollen. Mit 600 Reitern erschien er (1442) vor dem Spandauer Tor, das ihm von der Bürgerschaft bereitwillig geöffnet wurde. Er trat nun als Landesherr und oberster Richter auf und forderte Rechenschaft vom Rat wegen der eigenmächtigen Neuerungen im Stadtregiment und der darüber aus der Bürgerschaft vorgebrachten Klagen. Die Folge war, dass der Rat der Doppelstadt, dessen rechtliche Existenz der Kurfürst offenbar nicht anerkannte, seine Ämter niederlegte und die Schlüssel der beiden Städte an den Kurfürsten auslieferte. Friedrich nahm nun eine „Reformation“ der Stadtverfassung vor, indem er die eigenmächtige Verbindung der beiden Städte auflöste und, wie es heißt, „auf Bitten der Bürgerschaft“ neue Räte in Berlin und in Cölln einsetzte, in denen nun namentlich auch Männer aus den Viergewerken vertreten waren. Für die Zukunft behielt er sich das Recht der Bestätigung der Ratsmitglieder vor. Die bisherigen Bündnisse der Städte mit anderen märkischen und auswärtigen Städten (also auch ihre Zugehörigkeit zur Hansa) wurden für kraftlos erklärt, soweit sie nicht vom Landesherrn bestätigt würden. Die beiden Städte mussten ferner auf das bisher gehandhabte Niederlagsrecht verzichten, das den Durchfuhrhandel fremder Kaufleute und Schiffer zu ihren Gunsten gehindert hatte. Das Gericht, das in den Besitz der Städte gekommen war, nahm der Kurfürst wieder an sich. Außerdem ließ er sich einen Platz zwischen den beiden Städten, auf Cöllner Gebiet, abtreten, um dort ein Schloss zu errichten, das der landesherrlichen Gewalt in Zukunft als Stützpunkt dienen sollte. Indessen dieser große Erfolg, der in einer Urkunde von 1442 verbrieft war, ist dann noch einmal in Frage gestellt worden. Offenbar in Verbindung mit dem Fortschritt des Schlossbaues, der erst seit 1447 lebhafter gefördert wurde, und der nun auch in der Bürgerschaft Befürchtungen wegen Erhaltung der städtischen Freiheiten hervorrufen mochte, kam es zu Reibungen mit den landesherrlichen Dienern und schließlich im Januar 1448 zu einem Aufstande, dem sogenannten „Berliner Unwillen“, der sich gegen jene Reformation von 1442 richtete und eine Wiederherstellung der städtischen Autonomie zum Ziel hatte. Bei diesem Aufstande hat auch wieder ein Patrizier, der Bürgermeister Bernd Ryke, als Führer der unzufriedenen Gemeinde eine Rolle gespielt. Indessen der Aufstand wurde bald gedämpft; während der Kurfürst eine Anzahl von den Stadtdörfern besetzt hielt, wurde die ganze Angelegenheit den in Spandau versammelten Landständen zur Entscheidung vorgelegt, und ein aus diesen zusammengesetztes Gericht fällte den Spruch, das die Städte von Rechts wegen verbunden seien, die Verträge von 1442 zu halten. Diesem Spruch haben sich dann Berlin und Cölln durch eine Urkunde vom 19. Juni 1448 unterworfen. Der Schlossbau ging fort und wurde 1451 beendigt. Die Städtebündnisse wurden von neuem verboten, namentlich auch die Verbindung mit der Hansa, an der Berlin auch noch in den letzten Jahren einen Rückhalt für seine Selbstständigkeit gesucht hatte. Die fürstliche Gewalt hatte also hier einen vollständigen Sieg davongetragen, und mit Berlin und Cölln, die damals schon als die weitaus mächtigste Gemeinde im Lande galten, war auch den übrigen Städten der Mark jede Lust zum Widerstand gegen die landesherrliche Gewalt benommen. An wenigen Stellen in Deutschland ist damals in dem Zeitalter der „Städtekriege“, wo es sich darum handelte, ob die Städte ihre Selbstständigkeit gegenüber der aufsteigenden landesfürstlichen Gewalt würden behaupten können, ein so unzweideutiger Sieg der letzteren errungen worden. Die Eingliederung der märkischen Städte in den territorialfürstlichen Staatsverband war damit entschieden; der damals gefährlichste Gegner der landesherrlichen Hoheit war zur Unterwerfung gezwungen worden.
Nicht minder bedeutend sind die Erfolge, die die landesfürstliche Politik Friedrichs auf dem Gebiete des Kirchenregiments errang. Wie sein Bruder hatte sich Friedrich 1447 an das kirchenpolitische System angeschlossen, das im Gegensatz zu der vom Basler Konzil beanspruchten Superorität dem Papst nach wie vor die oberste Stellung in der Kirche zuerkannte, während dafür der weltlichen Gewalt, wie sie in Deutschland schon vorwiegend in den Landesfürsten sich darstellte, wichtige Befugnisse des Kirchenregiments, gleichsam als Erbstücke der in sich zusammengebrochenen päpstlichen Weltherrschaft, überlassen wurden. Auf dieser Idee der sogenannten „Fürstenkonkordate“ beruhen auch die Abmachungen des Kurfürsten von Brandenburg mit der Kurie, insbesondere mit dem Papst Nikolaus V., die in einer ganzen Reihe von päpstlichen Bullen niedergelegt sind, von denen die wichtigsten das Datum des 10. September 1447 tragen. Dadurch erhielt der Kurfürst vor allem das wichtige Recht der Ernennung (Nomination) der Bischöfe seiner Landesbistümer (Brandenburg, Havelberg, Lebus), während sich der Papst nur den formellen Akt der Provision vorbehielt. Ferner wurde die während der anarchischen Zeit des 14. und 15. Jahrhunderts übermäßig ausgedehnte geistliche Gerichtsbarkeit, die größtenteils geradezu an Stelle der verfallenen weltlichen getreten war, wieder in ihre Schranken verwiesen, indem der Papst dem Kurfürsten die alleinige Zuständigkeit der landesherrlichen Gerichte in allen Zivil- und Kriminalsachen zusicherte und allen geistlichen Richtern verbot, märkische Untertanen diesem Privileg zuwider zu belästigen. Wie stark die Einmischung der geistlichen Gerichtsbarkeit in rein weltliche Sachen damals empfunden wurde, zeigt auch eine Abmachung, die kurz vorher, 1445, auf einem Herrentage zwischen Prälaten und Ritterschaft vereinbart worden war, das nämlich den Patrimonialgerichten der Ritterschaft das Recht der ersten Instanz für ihre Gerichtseingesessenen gewahrt bleiben und das geistliche Gericht erst dann solle eingreifen dürfen, wenn innerhalb sechs Wochen die Partei, welche das Gericht angerufen, kein Recht habe erlangen können. Das galt damals schon als eine bedeutende Errungenschaft der weltlichen Gerichtsbarkeit, die von der geistlichen ganz zurückgedrängt worden war. Und wie diese Bestimmung für die Patrimonial-gerichte, so hatte jenes päpstliche Privileg von 1447 für die kurfürstlichen Gerichte eine epochemachende Bedeutung. In Bezug auf die geistliche Gerichtsbarkeit selbst aber, in ihren gesetzlichen Grenzen, wurde bestimmt, dass, soweit auswärtige Bischöfe an deren Ausübung beteiligt waren, die märkischen Untertanen doch nicht vor deren Gerichte außerhalb der Landesgrenzen zitiert werden dürften: so musste der Bischof von Halberstadt einen besonderen Kommissarius in Stendal halten zur Ausübung der geistlichen Jurisdiktion in der Altmark, die zu seiner Diözese gehörte. Ebenso wurden die Domstifter dem Einfluss auswärtiger geistlicher Oberen entzogen. Die Domherrenstellen und sonstige Stiftspfründen wurden in verschiedenartigen Formen der Verfügung des Landesherrn überlassen. Er durfte auch besondere weltliche Personen den Pröpsten der Frauenklöster beiordnen, um über deren Vermögen und dessen Verwendung eine landesherrliche Aufsicht zu führen; auch wurde ihm die Verfügung über den zu Festen und Mahlzeiten bestimmt gewesenen Teil der Einkünfte der Kalandsbrüderschaften überlassen, natürlich zum Zwecke der Ausübung von Wohltätigkeit, wie sie der Bestimmung dieser frommen Stiftungen entsprach. Im Zusammenhang mit der spezifisch märkischen Färbung der Kirchenpolitik stand auch, das Friedrich das sogenannte „Wunderblut“ zu Wilsnack, dessen Pfarrkirche mit ihren blutschwitzenden Hostien zu einer berühmten Wallfahrtsstätte geworden war, gegen die Einmischung des Erzbischofs von Magdeburg in Schutz nahm und zugunsten der Wallfahrer sogar einen besonderen päpstlichen Ablass auswirkte. Fast man das alles zusammen, so kann man sagen: der Kurfürst erwarb durch diese Privilegien die wesentlichsten Befugnisse der bisher vom Papst ausgeübten oder beanspruchten Kirchenhoheit in seinem Lande samt einer weitgehenden Verfügung über die Einkünfte kirchlicher Stiftungen; er war mit Erfolg bestrebt, sein Territorium kirchenpolitisch zu einer annähernden Einheit zusammen- und nach außen abzuschließen. Es würde zu weit gehen, wenn man behaupten wollte, das damit bereits die Anfänge einer brandenburgischen Landeskirche schon in katholischer Zeit vorhanden gewesen wären; aber eine Grundlage war allerdings geschaffen, auf der später eine solche Landeskirche erbaut werden konnte.
Hatte Friedrich so die privilegierten Stände des Landes, Ritterschaft, Städte, Geistlichkeit, in eine mehr oder minder enge Abhängigkeit von sich gebracht und damit den territorialen Staatsverband nach langer Auflockerung erst wieder befestigt oder eigentlich aufs neue begründet, so war er andererseits auch bemüht, die Pflichten der landesfürstlichen Obrigkeit namentlich durch die Herstellung von Recht und Gericht in höherem Maße, als es bisher geschehen war, zu erfüllen. Unter seiner Regierung hören wir zum ersten Mal wieder von einem Kammergericht, ohne das freilich viel mehr als der bloße Name davon überliefert wäre. Wir dürfen aber vermuten, dass es ähnlich wie am Hofe des Kaisers aus den Räten zusammengesetzt war, die den Kurfürsten beständig umgaben, und dass es in dem neu erbauten Schlosse zu Cölln an der Spree gehalten worden ist. Von dem Hofgericht, bei dem nach wie vor die Vasallen das Urteil fanden, ist es jetzt zu unterscheiden. Dieses Hofgericht ist offenbar das alte Berliner Distriktshofgericht über die Mittelmark, das in dem früheren Rathause der Doppelstadt Berlin-Cölln auf der Langen Brücke (heute Kurfürstenbrücke) zwischen den beiden Städten gehalten wurde. Zu der Zeit, wo die Altmark noch in den Händen des jüngeren Bruders war und die Herrschaft Friedrichs II. sich im Wesentlichen auf die Mittelmark beschränkte, wurde dieses Hofgericht auf eine leicht begreifliche Weise als das „oberste“ angesehen und bezeichnet, oder auch als „das Hofgericht“ schlechthin. Das Organ der obersten, persönlichen Gerichtsbarkeit des Kurfürsten ist es aber nicht mehr gewesen. Friedrich hat es 1450 dem Ritter Paul von Kunersdorf zu Lehen gegeben, und diesen finden wir in der Folgezeit vielfach als Hofrichter in Urkunden bezeugt. Das alte Reichshofgericht ist ja eben damals eingegangen, und auch das märkische hat mit dem Eindringen des römischen Rechts die alte Grundlage seiner Wirksamkeit verloren. Immerhin hat es sich noch etwa hundert Jahre lang gehalten.
Der Schwerpunkt der Verwaltung, auch der finanziellen, lag damals noch in der kurfürstlichen Kanzlei. Auf eine Veränderung ihres Betriebes deutet es, das 1444 der erste weltliche Kanzler erscheint, in der Person des lausitzischen Edlen Heinz von Kracht. Aus dem Jahre 1450 stammen die ersten Schoßregister, die uns erhalten sind. Sonst war die finanzielle Verwaltung in der Mark aber noch sehr unentwickelt; die Beamten Albrechts fanden, das die märkischen Schreiber von Rechnungssachen nichts verständen, und Albrecht selbst hat von seinem Bruder geurteilt, das er nicht hauszuhalten verstehe und seinen Amtleuten mehr zukommen lasse als er selbst zu erheben habe. Friedrich hatte offenbar in Finanzsachen eine breitere Natur und nicht die berechnende Schärfe seines fränkischen Bruders. Wenn aber seine Regierung mit einer nicht unbedeutenden Schuldenlast abgeschlossen hat, so lag die Ursache dafür in den großen Kosten, die seine auswärtige Politik, so wohlbedacht sie war, und so sehr sie sich auf das Notwendige beschränkte, mit sich brachte, und in der Tatsache, dass Albrecht es immer abgelehnt hat, aus seinen reicheren Mitteln für diese Zwecke beizutragen.
Der Grundgedanke dieser ganzen auswärtigen Politik war das Bestreben, möglichst viel von dem wiederzugewinnen, was einst zur Kurmark Brandenburg gehört hatte. Es ist bezeichnend für die Art Friedrichs II., das er sich dazu auf dem Nürnberger Reichstage 1444 ein förmliches Revindikationsmandat (Revindikation (zu lat. re- und vindicatio = Anspruchs-recht, also so viel wie Zurückforderung, Wiederinan-spruchnahme). Als Revindikation wird der Versuch sma. Herrscher (Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII.) bezeichnet, vormalig dem Königtum zukommende und zwischenzeitlich in andere Hände gelangte Reichsgüter und Gerechtsame wieder an sich zu bringen) des Kaisers ausgewirkt hatte, in dem anbefohlen war, das alles Entfremdete der Mark zurückgegeben werden solle. Am ersten gelang eine Auseinandersetzung mit Mecklenburg. Nach zweijährigem Krieg kam es, schon 1442, in Wittstock zu einer Vereinbarung, wonach — abgesehen von einer kleinen Grenzberichtigung — gegen den Verzicht auf das einst unter brandenburgische Lehnshoheit getretene Gebiet der Herren von Werle ein Erbvertrag geschlossen wurde, auf Grund dessen das Haus Brandenburg nach Erlöschen der männlichen Linien der mecklenburgischen Herzogshäuser ihnen im Besitz des Landes folgen sollte. (Der Vertrag besteht noch heute.) Durch einen Vertrag mit dem Erzbischof von Magdeburg von 1449 wurden endgültig die Lehnsansprüche des Erzstifts auf brandenburgisches Gebiet beseitigt; zugleich wurde eine Grenzregulierung vorgenommen, durch welche Jerichow und andere streitige Orte dem Erzstift überlassen wurden, wogegen dieses die brandenburgische Hoheit über die Stolbergsche Grafschaft Wernigerode anerkannte.
Im Jahre 1448 ließ sich Friedrich von der Familie Polenz die Niederlausitz übertragen, die diese 1422 als eine Landvogtei von König Sigmund pfandweise unter Vorbehalt der Wiedereinlösung erworben hatte. Die Stände der Niederlausitz leisteten auch die Huldigung, aber der Besitz des Landes ließ sich gegenüber den Ansprüchen des Böhmenkönigs Georg Podiebrad nicht auf die Dauer halten. In dem Vertrag zu Guben, 5. Juni 1462, musste ihm Friedrich die Niederlausitz überlassen; er behielt aber — als böhmisches Lehen — die schon 1445 durch Kauf erworbenen Herrschaften Kottbus und Peitz, die als Enklaven in der Niederlausitz lagen, samt dem an die Mittelmark sich anschließenden Lande Teupitz (mit Wusterhausen) und einigen anderen Besitzungen; dazu kam die Anwartschaft auf die ebenfalls unter böhmischer Hoheit stehenden Herrschaften Beeskow und Storkow, die allerdings erst ein Jahrhundert später, unter Johann Georg (1575), endgültig in brandenburgischen Besitz gelangt sind.
Die Herrschaft eines tschechisch-hussitischen Königs in Böhmen, die das Land aus der bisherigen Verbindung mit dem Hause Habsburg löste und ehrgeizige Ausdehnungsbestrebungen mit sich brachte, bedeutete seit 1458 eine wesentliche Erschwerung der Lage für die Politik der hohenzollernschen Brüder; eine Erbvereinigung zwischen Brandenburg, Hessen und Sachsen, die 1457 geschlossen worden ist, war vornehmlich bestimmt, der böhmischen Macht ein Gegengewicht zu schaffen; aber weder die brandenburgischen noch die fränkischen Interessen konnten sich durchsetzen, wo sie mit Böhmen in Konflikt gerieten, und es blieb schließlich den hohenzollernschen Brüdern nichts übrig, als sich mit Georg Podiebrad zu verbinden und an diesem Bündnis festzuhalten, selbst als er mit Papst und Kaiser in Zwist geriet.
Der bedeutendste Erfolg der Revindikationspolitik Friedrichs war die Wiedererwerbung der Neumark, die schon ganz in den Besitz des Ordens übergegangen war und zweifellos 1466 mit Westpreußen zugleich eine Beute Polens geworden wäre, wenn sie damals noch dem Orden gehört hatte. In der Not des letzten Krieges mit Polen ließ sich der Hochmeister Ludwig von Erlichshausen 1455 dazu herbei, das Land gegen eine Zahlung von 40 000 Gulden auf Wiederkauf an den brandenburgischen Kurfürsten zu veräußern. Friedrich hat seinen Nachfolgern ans Herz gelegt, dafür zu sorgen, „dass solch Land, die Neumark, bei deutschen Landen und dem würdigen Kurfürstentum der Mark zu Brandenburg, der es bei Ansetzung der Kur einverleibt ist, bleibe und nicht zu undeutsch Gezunge gebracht werde“. Er hatte das Bewusstsein, dieses Stück deutschen Landes den Griffen der Polen entrissen zu haben und es auch weiterhin davor hüten zu müssen.
Ein ähnlicher nationaler Unterton begleitet die schwerste seiner auswärtigen Unternehmungen, den Versuch zur Erwerbung von Pommern. Zugleich ist es die Gewinnung der Seeküste, die er dabei ins Auge gefasst hatte. Er meinte, durch die Vereinigung mit Pommern würde Brandenburg die vorwaltende Macht in Niederdeutschland werden. In beständigen Grenzkriegen hatte er zunächst die Pommern aus den Städten und Schlössern der Uckermark zu vertreiben gesucht, in denen sie noch von der Zeit seines Vaters her saßen. Er hatte Stolpe, Greiffenberg, Zichow eingenommen; aber Pasewalk und Torgelow, die den Zugang zum Haff beherrschten, waren in den Händen der Pommern geblieben. Da starb 1464 der Stettiner Herzog Otto III., der letzte männliche Spross dieser Linie des Greifenhauses, und Friedrich beanspruchte nun auf Grund des Erbvertrages die Nachfolge. Er hatte auch bereits eine Partei im Lande, die dafür eintrat. Aus Thomas Kantzows pommerscher Chronik ist die Szene bekannt, wie beim Begräbnis des Herzogs der Stettiner Bürgermeister von Glinden Helm und Schild mit in den Sarg wirft, wie es bei ausgestorbenen Geschlechtern üblich war, mit den Worten: Da liegt unsere Herrschaft von Stettin! Und wie dann ein Gegner der brandenburgischen Partei, der Ritter von Eichstedt, die Waffen wieder aus der Gruft heraufholt und dabei das Erbrecht der Wolgaster Linie verkündet. Es mag eine Legende sein, aber sie bringt den Gegensatz der Ansprüche und der Parteien zu anschaulichem Ausdruck. Die Wolgaster beriefen sich auf das eben damals bei der Rezeption der fremden Rechte miteindringende langobardische Lehnrecht, das die „gesamte Hand“ überall voraussetzt und ein Lehen erst für eröffnet erklärt, wenn der letzte männliche Nachkomme des ersten Erwerbers gestorben ist. Der Kaiser machte dem Brandenburger Schwierigkeiten. Er verlangte für die Belehnungsurkunde eine ungewöhnlich große Summe, 37 000 Gulden. Friedrich war nicht gewillt, diesen tatsächlich doch ziemlich wertlosen Akt so teuer zu erkaufen. Er suchte zuerst durch Verhandlungen mit den Wolgaster Herzögen 1466 die Anerkennung der Lehnsherrlichkeit Brandenburgs und einen Erbvertrag mit dieser Linie zu erreichen. Aber da diese Verhandlungen nicht zum Ziel führten und der Kaiser, weil die hohenzollernschen Brüder ihre Verbindung mit dem Böhmenkönig Georg Podiebrad nicht auf geben wollten, sich schließlich auf die Seite Pommerns stellte, da entschloss sich Friedrich, die Entscheidung der Waffen anzurufen, obwohl er von seinem Bruder Albrecht die erbetene finanzielle Unterstützung (20 000 Gulden) nicht erlangen konnte. 1468 zog er über Pasewalk vor Stettin, konnte es aber nicht einnehmen.
1469 belagerte er vergeblich Uckermünde, das den Zugang zur unteren Oder beherrscht. Er musste schließlich einen Waffenstillstand schließen, den der König von Polen vermittelte. Ein Teil des Herzogtums Stettin blieb in seinen Händen: u. a. die Städte Garz und Schwedt, die Schlösser Vierraden und Löcknitz. Aber er war krank und fühlte nicht mehr die Kraft, das Begonnene zu vollenden. Außerdem war er durch den Tod seines einzigen Sohnes 1467 der Hoffnungen für seinen eigenen Stamm beraubt. Im Jahre 1470 Schloss er mit seinem Bruder Albrecht ein Abkommen, wonach er diesem die Regierung in der Mark überließ gegen ein Jahresgehalt von 6000 Gulden und die Einräumung der Plassenburg, wohin er sich zurückzog, um den Rest seiner Tage in Frieden zu verleben. Seine Gemahlin, die Prinzessin Katharina von Sachsen, mit der er seit 1441 in einer, wie es scheint, nicht sehr glücklichen Ehe lebte, blieb in Brandenburg zurück. Am 10. Februar 1471 ist er in Franken gestorben. Auch er hat das begonnene Werk noch nicht vollenden können; aber man wird doch sagen dürfen, dass die territoriale Konsolidierung der Mark Brandenburg, ihr Ausbau zu einem Staat ähnlichen Gebilde vornehmlich sein Werk gewesen ist.