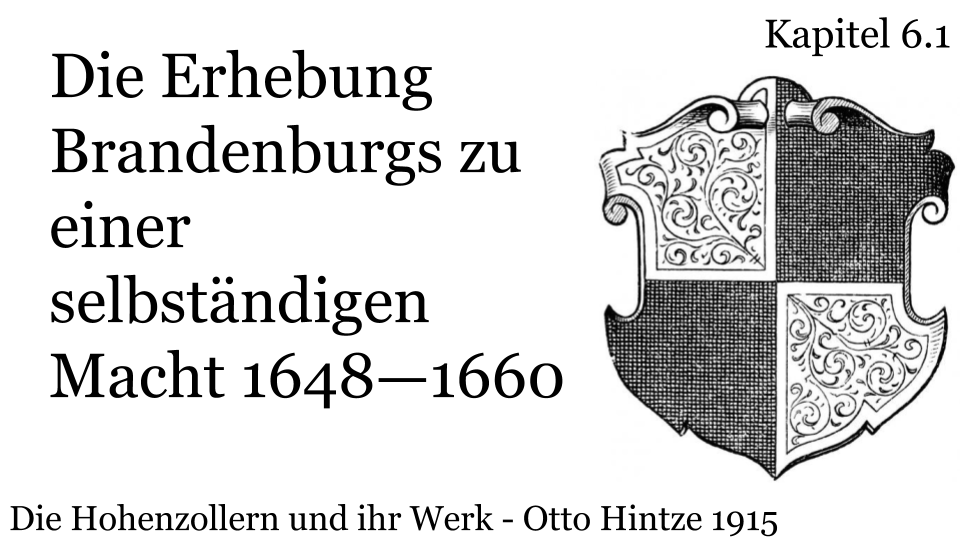
6.1 Die Erhebung Brandenburgs zu einer selbständigen Macht (1648 – 1660)
Das beherrschende Verhältnis in dem europäischen Staatensystem nach dem Westfälischen Frieden war die Schwächung der habsburgischen Mächte Österreich und Spanien und das Aufsteigen ihrer Gegner und Rivalen, der beiden verbündeten Kronen Frankreich und Schweden. Der Kaiser hatte seinen spanischen Verbündeten im Stich lassen und mit den Gegnern einen Separatfrieden schließen müssen; Spanien kämpfte bis 1659 allein mit Frankreich weiter, aber seine Aussichten auf eine Wiederherstellung des alten habsburgischen Übergewichts waren sehr gering. Die spanische Machtstellung am Rhein entlang war zusammengebrochen, und der Versuch des österreichischen Kaisers, das Reich seiner Botmäßigkeit zu unterwerfen, war gescheitert. Das Gleichgewicht der Mächte war wiederhergestellt und der Druck der österreichisch-spanischen Übermacht, der früher auf Brandenburg gelastet hatte, war von ihm genommen. Dass es trotz der kläglichen Rolle, die es im Dreißigjährigen Kriege gespielt hatte, doch noch mit einem vergrößerten Landbesitz aus dem Westfälischen Friedensschluss hervorging, verdankte es mehr der Erschöpfung Österreichs und den Gleichgewichtsbestrebungen der französischen Politik, als seiner eigenen Bedeutung und der Geschicklichkeit seiner Diplomaten bei den Friedensverhandlungen. Es war die erste günstige Wirkung der neuen Konstellation der Mächte. Später trat noch der Umstand hinzu, dass Österreich seine Kräfte vornehmlich gegen die Türkei zu richten begann, um sich zum wirklichen Herrn von Ungarn zu machen — eine sehr bedeutende Stärkung der österreichischen Monarchie, die aber ein Emporkommen Preußens nicht hemmte, sondern eher begünstigte. Durch den Gegensatz zwischen Schweden und Polen und durch die Einmischung Gustav Adolfs in den deutschen Krieg war zum ersten Mal in der Weltgeschichte eine lebendige allseitige politische Berührung der europäischen Mächte untereinander herbeigeführt worden, und dem Hause Brandenburg hatte das Schicksal seine Stellung mitten zwischen diesen rivalisierenden Mächten, Frankreich und Österreich, Schweden und Polen angewiesen. Durch seine weit auseinanderliegenden Besitzungen wurde es mit der westlichen wie mit der östlichen Hälfte des europäischen Staatensystems in Berührung gebracht und von allen bedeutenden Vorgängen der einen wie der andern in Mitleidenschaft gezogen. Aber diese schwierige Lage, der Johann Sigismund und Georg Wilhelm sich nicht gewachsen gezeigt hatten, bot jetzt unter den veränderten Umständen dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm die Möglichkeit dar, sich durch kluge Benutzung der Rivalität unter den großen Mächten und durch eine Politik des Balancierens allmählich in die Höhe zu bringen und eine selbständige Stellung unter den Machten einzunehmen. Das ist das allgemeine Ziel seines Strebens in den Jahren nach dem Westfälischen Frieden; unter diesem Gesichtspunkt muss seine vielfach sprunghafte, lavierende, gewundene Politik aufgefasst werden.
Die Ausführung der Bestimmungen des Westfälischen Friedens hat die Diplomaten noch jahrelang beschäftigt. Brandenburg ist nur schwer zu seinem Recht gekommen. Die Schweden hielten ganz Pommern besetzt und wollten vor einer genauen Grenzregulierung nichts davon herausgeben; noch in dem „Friedens-Exekutions-Haupt-Rezess“ von 1650 war für Pommern eine Ausnahme gemacht.
Die Besitzverhältnisse am Niederrhein waren auch durch den Westfälischen Frieden nicht endgültig geregelt worden; der Kurfürst hatte zwar, nachdem 1646 ein Versuch, das Herzogtum Berg zu erobern, gescheitert war, in dem Düsseldorfer Vertrag von 1647 sich bei dem bestehenden Zustand vorläufig beruhigt; aber dieser Teilungsvertrag galt wie alle vorhergehenden nur als ein Provisorium, und jeder der beiden „possidierenden“ Fürsten hielt noch den Anspruch und die Hoffnung auf das Ganze fest. Nach dem Friedensschluss kam es wegen der Religionsfragen zu Reibungen zwischen Brandenburg und Pfalz-Neuburg. Der Westfälische Friede hatte im Allgemeinen das Jahr 1624 als Normaljahr für den Stand der Konfession bestimmt, während die beiden possidierenden Fürsten in einem früheren Vertrage das Jahr 1612 festgesetzt hatten. Zwischen diesen Terminen lag das Vordringen der katholischen Restauration in diesen Landen.
Der Pfälzer stützte sich nun auf die allgemeine Bestimmung des Reichsfriedens und führte demgemäß in Jülich und Berg die katholische Restauration auf Grund des Jahres 1624 durch; der Brandenburger berief sich auf die frühere Abmachung und trat für die geschädigten Protestanten ein. Aus dieser Feindseligkeit erwuchs der Plan des Kurfürsten, durch einen Handstreich die neuburgischen Landesteile zu erobern. Im Juni 1651 marschierte er in Jülich ein und forderte die Stände auf, sich ihm anzuschließen. Aber das Unternehmen war schlecht vorbereitet, militärisch wie politisch, und scheiterte völlig. Die Stände von Jülich-Berg verbanden sich mit denen von Cleve-Mark zum Widerstande. Der Kaiser nahm sofort Partei gegen Brandenburg, ebenso Spanien und Polen. Im Reiche schalt man überall auf den Friedensbrecher, der den allgemeinen Krieg wieder entzünden zu wollen schien. Dazu ist es nun freilich nicht gekommen; der jülichsche Feldzug ist still und ohne weitere Folgen im Sande verlaufen. Der Kurfürst hat keine von seinen Forderungen durchgesetzt; auch die Religionsstreitigkeiten blieben vorläufig noch ungeschlichtet. Aber eine sehr wichtige Wirkung für die brandenburgische Politik hatte diese misslungene Unternehmung doch gehabt: sie brachte eine Umwendung der politischen Richtung hervor; Brandenburg schloss sich für eine kurze Zeit an den Kaiser an, der schließlich durch seine Vermittlung den Zwischenfall erledigt hatte. Eben damals geht die Ära des maßgebenden Einflusses Burgsdorffs zu Ende. Sein hoch fahrendes Wesen, das namentlich der Kurfürstin und ihrer Mutter missfiel, ebenso wie die wohl mehr der Vergangenheit angehörigen Anstößigkeiten seines Privatlebens, die von einer verleumderischen Clique auf das Stärkste übertrieben worden waren, dazu auch wohl seine allmählich hervortretende Unzulänglichkeit gegenüber den neuen Aufgaben, seine Ohnmacht gegenüber der bisher herrschenden finanziellen Misswirtschaft, für die man ihn verantwortlich zu machen geneigt war — das alles hat schon 1651 dazu geführt, dass ihn der Kurfürst von seinem Hoflager zu Cleve fortschickte; sein weiteres Verhalten machte ihn dann vollends unmöglich; im Jahre 1652 erhielt er seine Entlassung in ziemlich ungnädiger Form; der schwer Erkrankte hat sie nur um wenige Tage überlebt. An seiner Stelle traten nun namentlich zwei Staatsmänner hervor, die miteinander rivalisierten und ganz verschiedene Richtungen vertraten: Waldeck und Blumenthal.
Graf Georg Friedrich von Waldeck, seit 1645 regierender Reichsfürst, fand in den engen Grenzen seines Ländchens nicht den nötigen Spielraum für seinen Ehrgeiz und seine militärisch-politischen Talente. Reformiert und durch seine nassauische Gemahlin mit dem oranischen Hause verschwägert, hatte er sich in den Niederlanden ausgebildet und als Oberst im Dienst der Republik gestanden; nach Wilhelms II. Tode, in der statthalterlosen Zeit, war er, seit 1651, in den brandenburgischen Dienst getreten. Er scheint im Einverständnis mit den oranischen Damen den Anstoß zur Entlassung Burgsdorffs und in Verbindung damit auch zu den inneren Reformen gegeben zu haben, die seit 1651 auf die Bahn gebracht wurden, namentlich um das vernachlässigte Finanzwesen für die Zwecke einer militärisch-politischen Machtentfaltung nutzbar zu machen und um eine bessere Ordnung und Geschäftsverteilung beim Geheimen Rat durchzuführen, der aus einer brandenburgischen Behörde nun zum Zentralorgan einer komplizierten Gesamtstaatsverwaltung geworden war. Den einzelnen Mitgliedern sind in der neuen Ordnung von 1651 feste Dezernate zugewiesen worden; Waldeck selbst erhielt dabei die Bearbeitung der hochpolitischen Angelegenheiten (der sogenannten „geheimen Sachen“) und die Leitung des gesamten Kriegswesens. Seine politische Richtung wies auf Annäherung an die protestantischen Mächte, namentlich die Niederlande und Schweden, und auf den Gegensatz zum Kaiser hin. Aber diese Richtung entsprach nicht den Forderungen des Tages, und darum ist nicht Waldeck, sondern Blumenthal zunächst der maßgebende Mann unter den Räten des Kurfürsten geworden, der alte Freund und Gehilfe des Grafen Schwartzenberg. Als Kanzler des halberstädtischen Stiftes war er 1650 wieder in den brandenburgischen Dienst getreten, und bei einer abermaligen Umgestaltung des Geheimen Rats im Jahre 1652 trat er an dessen Spitze als Direktor — gewissermaßen als Ersatz für den letzten brandenburgischen Kanzler, den alten Götzen, der 1650 gestorben war und dessen Stelle nicht wieder besetzt worden ist. Blumenthal ist es nun vor allen gewesen, der den Kurfürsten bestimmt hat, nach der Erledigung des jülichschen Streites in nähere Verbindung mit dem Kaiser zu treten. Dem Kaiser, Ferdinand III., kam es damals darauf an, die brandenburgische Kurstimme für die Königswahl seines Sohnes (Ferdinand) zu gewinnen und sich das Entgegenkommen Brandenburgs bei den Verhandlungen des bevorstehenden Reichstags zu sichern, dem die Ordnung der Verfassungsverhältnisse erhalten worden war. Brandenburg aber hatte die pommersche Frage im Auge; es brauchte die Hilfe des Kaisers, um einen Druck auf Schweden in dieser Angelegenheit auszuüben. Gegen die Zusicherung der brandenburgischen Stimme bei der Königswahl für seinen Sohn erlies dann in der Tat der Kaiser ein Dekret des Inhalts, das Schweden zu dem bevorstehenden Reichstage nicht eher zugelassen werden könne, als bis es den Friedensbestimmungen gemäß Hinterpommern an den Kurfürsten von Brandenburg herausgegeben haben würde. Darauf hat Schweden nachgegeben. Die Verhandlungen über die Grenzregulierung wurden nun bald zum Abschluss gebracht, und der Stettiner Vertrag vom 14. Mai 1653 setzte den Kurfürsten endlich in den Besitz des ihm zukommenden Landes. Die Grenzregulierung war für Brandenburg sehr ungünstig ausgefallen: ein breiter Landstreifen rechts von der Oder mit den Städten Damm, Gollnow, Greifenhagen blieb in den Händen der Schweden. Von den Lizenzen, den Seezöllen in den hinterpommerschen Hafenplätzen, die Gustav Adolf so stark erhöht hatte, musste ihnen die Hälfte des Ertrages überlassen werden.
Soweit war Brandenburg mit dem Kaiser gegangen; aber auf dem Reichstag zu Regensburg, wo nun die großen Fragen der Reichsverfassung zur Erörterung kamen, ist das bisherige Einvernehmen sehr bald, schon 1653, wieder in die Brüche gegangen. Der Kaiser nahm seit der Königswahl seines Sohnes (31. Mai 1653) keine Rücksicht mehr auf Brandenburg, das seine Beschwerden wegen Jägerndorf, wegen einer alten Schuldforderung, wegen Unterdrückung der Protestanten in Schlesien, Österreich und Ungarn jetzt wieder vorbrachte; die Klagen eines clevischen Vasallen des Kurfürsten, Wilich von Winnenthal, wegen Verletzung der landständischen Rechte in den niederrheinischen Territorien, wurden vom Kaiser am Reichstage nicht ungünstig aufgenommen, ebenso die Beschwerden der Stadt Herford, die reichsstädtische Selbstständigkeit begehrte. Dazu kam der Gegensatz der Interessen in den Reichsverfassungsfragen. Der hauptsächlichste Punkt betraf die Frage, ob bei der Bewilligung der Matrikularbeiträge für Reichszwecke ein Majoritätsbeschluss auch die abwesenden oder die widersprechenden Reichsstände binden könne. Der Kaiser suchte den Grundsatz zur Anerkennung zu bringen, dass die Mehrheit der Stimmen entscheiden solle, und im Herbst 1653 schien er die beste Aussicht zu haben, mit dieser Forderung durchzudringen. Hier setzte nun Waldeck den Hebel an, um das bisherige politische System umzuwälzen. Er stellte dem Kurfürsten vor, wie die Macht des Kaisers und der katholischen Partei dadurch gestärkt, die fürstliche Hoheit und das protestantische Interesse aber beeinträchtigt, der Erfolg der eben in Angriff genommenen brandenburgisch preußischen Finanzreform vereitelt werden würde. Dem kaiserlichen System Blumenthals setzte er ein System oppositioneller Reichspolitik an der Spitze der protestantischen Fürstenpartei entgegen. Blumenthal, der das Haupt der brandenburgischen Komitialgesandtschaft (Komitialgesandter war die Bezeichnung für einen Gesandten eines Reichsstandes im Heiligen Römischen Reich beim Immerwährenden Reichstag des Heiligen Römischen Reichs zu Regensburg in den Jahren von 1663 bis 1806, als die Fürsten kaum noch selbst vertreten waren, sondern sich durch Gesandte vertreten ließen. Die Bezeichnung geht zurück auf den Ausdruck der Comitia (Plural von lateinisch comitium „Versammlungsort“), die Bezeichnung für eine Volksversammlung im antiken Römischen Reich.) in Regensburg war, erhielt schon im Oktober 1653 die Anweisung, den Forderungen des Kaisers Widerstand zu leisten; bald darauf wurde er abberufen und durch einen glänzenden, aber ziemlich einflusslosen Ruheposten als Statthalter des Fürstentums Halberstadt auch von der Teilnahme an den Geschäften im Geheimen Rat tatsächlich ausgeschlossen. Nun kam das entgegengesetzte System Waldecks zum Durchbruch, wie er es in einer Denkschrift vom 31.Dezember 1653 entwickelt und in vertraulichen Korrespondenzen bis in seine weiteren Konsequenzen verfolgt hat. Er hatte eine brandenburgische Unionspolitik großen Stils im Auge. Brandenburg sollte an die Stelle von Kurpfalz und Sachsen treten als Führer der evangelischen Fürstenpartei im Reiche, die, gestützt auf auswärtige Subsidien, den Kampf gegen das habsburgische Kaisertum führen und die Krone des Reiches womöglich an ein anderes Haus, etwa Bayern, bringen sollte, unter dem dann Brandenburg selbst einen maßgebenden Einfluss in den Reichsangelegenheiten ausüben würde. Es sind Gedanken, wie sie schon früher begegnen und wie sie später Friedrich der Große wieder aufgenommen hat; sie sind damals noch nicht zur wirklichen Entfaltung gekommen. Der Kurfürst nahm allerdings das Programm an, und Waldeck begann im Jahre 1654 seine Bündnisverhandlungen, namentlich mit Braunschweig und anderen norddeutschen Fürsten und Reichsstädten. Von der früheren protestantischen Unionspolitik unterschieden sich seine Entwürfe dadurch, dass der konfessionelle Gesichtspunkt doch nicht mehr der allein maßgebende war. Er suchte vielmehr auch katholische Reichsstände zum Beitritt zu dem neuen Fürstenbund zu gewinnen, namentlich den Erzbischof von Köln, Maximilian Heinrich aus dem Hause der bayerischen Wittelsbacher, der kurz vorher (1652) mit den beiden anderen geistlichen Kurfürsten, dem Neuburger Pfalzgrafen und dem Bischof von Münster, zu einem katholischen Bunde zusammengetreten war und sich nun nicht unzugänglich für die brandenburgischen Pläne zeigte. Einen bedeutsamen Hintergrund erhielten diese Bestrebungen durch ganz geheime Unterhandlungen zwischen Waldeck und dem Kardinal Mazarin, die ein allgemeines europäisches Bündnis gegen Österreich und Spanien zum Ziel hatten. Man muss sich erinnern, dass ja Frankreich und Spanien damals noch im Kriege lagen. In diesen Verhandlungen wurde in Aussicht genommen, dass bei dem künftigen Friedensschluss die spanischen Niederlande an Frankreich, Jülich und Berg an Brandenburg kommen sollten. Waldeck verhehlte sich und dem Kurfürsten nicht, das der große Kampf, den er so wieder zu entfesseln gedachte, unter Umständen zur Zersprengung des Reichsverbandes führen könne; aber er meinte, wenn das Reich in Stücke ginge, werde Brandenburg davon ein großes Stück für sich behalten können.
Man wird bezweifeln dürfen, ob die damaligen Kräfte Brandenburgs ausgereicht haben würden, eine solche Rolle in der Welt zu spielen. Es ist auch zweifelhaft, wie weit der Kurfürst mit Waldeck in dieser Richtung gegangen sein würde. Die Bündnisverhandlungen Waldecks hatten zunächst nur einen bescheidenen Erfolg. Mit Braunschweig kamen sie 1655 zu einem erwünschten Abschluss, aber der Erzbischof von Köln trat bald wieder auf die katholische Seite zurück. Während also der gegen Habsburg gerichtete Fürstenbund noch in den ersten Anfängen sich befand, brach an einer andern Stelle des politischen Horizonts ein Wetter aus, das schon lange gedroht hatte und das die brandenburgische Politik auf Jahre hinaus in Atem halten sollte: im Juli 1655 begann Karl X. Gustav von Schweden den Krieg gegen Johann Kasimir von Polen, der den Zweibrücker Pfälzer nicht als Nachfolger auf dem Wasathron anerkennen wollte. In diesem Kampf musste der Kurfürst als Herzog von Preußen Stellung nehmen.
Es war eine sehr schwierige Lage. Sollte er dem König von Polen die verlangte Lehnshilfe leisten, auf die Gefahr hin, dass der siegreich vorrückende Schwedenkönig Preußen, das ja schon stets ein Gegenstand der schwedischen Begehrlichkeit gewesen war, in seine Gewalt brachte, um die Ostsee allmählich zu einem schwedischen See zu machen? Oder sollte er, wie Waldeck riet, mit ganzer Macht, in imponierender Rüstung sich an die Seite Schwedens stellen, das sinkende Polenreich zertrümmern helfen, die Souveränität in Preußen und eine polnische Ländermasse, womöglich eine solche, die Preußen mit der Neumark und Pommern verband, sich erkämpfen? Am liebsten hätte er es mit einer bewaffneten Mediation versucht; aber dafür war Schweden nicht zu haben. In Verhandlungen, die zunächst (Juli und Anfang August 1656) in Stettin geführt wurden, war Karl Gustav einen Moment lang bereit, gegen eine Waffenhilfe mit 8.000 Mann die Souveränität in Preußen zuzugestehen, aber ohne große polnische Erwerbungen; und da der Kurfürst nicht sofort Zugriff und inzwischen die schwedischen Waffen siegreich in Großpolen vordrangen, stellte er bei den weiteren Verhandlungen, nun schon auf polnischem Boden, die abschreckende Forderung, dass der Kurfürst für Preußen sein Vasall werden müsse. So verharrte Friedrich Wilhelm zunächst in einer schwankenden Neutralität. Er rüstete aufs eifrigste, er schloss ein Bündnis mit den Ständen des polnischen Preußens, die gleichfalls neutral zu bleiben wünschten; im Sommer 1655 war auch endlich die langersehnte Allianz mit den Niederlanden zustande gekommen, die im Fall eines schwedischen Sieges für ihren Handel in den baltischen Häfen fürchteten. Der Kurfürst verhandelte nach allen Seiten; er suchte auch Anlehnung an den Kaiser, aber vergeblich. Inzwischen warf Karl Gustav in einem glänzenden Feldzuge das polnische Reich über den Haufen: König Johann Kasimir floh nach Oberschlesien, ein großer Teil des polnischen Adels schloss sich dem Sieger an; auch der russische Zar Alexei ging damals gegen Polen vor. Nach der Niederwerfung Polens aber rückte nun Karl Gustav gegen Preußen heran, das er als Operationsbasis beherrschen musste, und forderte die Unterwerfung des Kurfürsten. Friedrich Wilhelm sah sich in einer Zwangslage: seine Bündnisse versagten, er allein war den auf Königsberg anrückenden Schweden nicht gewachsen; so schloss er am 17. Januar 1656 den demütigenden Königsberger Vertrag ab, in dem er alle schwedischen Forderungen bewilligen musste: er nahm nun das Herzogtum Preußen samt dem bisher polnischen Ermland von Schweden statt von Polen zu Lehen, er öffnete den Schweden seine Häfen Pillau und Memel, er teilte mit ihnen auch hier die Hafenzölle, er musste für den Fall der Fortsetzung des Krieges eine Lehnshilfe von 1500 Mann versprechen. Es war trotz der Erwerbung von Ermland eine unzweifelhafte Verschlechterung der Lage in Preußen. Die Lehnsabhängigkeit von dem herrschsüchtigen und gewalttätigen Schwedenkönig bedeutete doch etwas ganz anderes, als das sanfte Joch der polnischen Suzeränität (Der Begriff der Suzeränität (französisch suzerain „Oberhoheit, Oberherrschaft, Lehnsherr“, als Parallelbildung zu souverain von frz. sus „hinauf, in der Höhe“ abgeleitet, das auf das gleichbedeutende lat. sursum, verkürzt aus subversum, zurückgeht[1]) wurde in der Frühen Neuzeit parallel zum Begriff der Souveränität entwickelt und bezeichnet die Oberhoheit eines Staates über einen anderen, der über eine begrenzte, unvollkommen ausgebildete Souveränität verfügt.[2]), dessen Druck seit der Thronbesteigung Johann Kasimirs sich sehr vermindert hatte. Der Kurfürst dachte schon daran, durch eine Unternehmung in den Rheinlanden sein gesunkenes Ansehen zu heben und schloss zu diesem Zweck im Februar 1656 ein Bündnis mit Frankreich, das ja zugleich mit Schweden in nahen Beziehungen stand. Aber die Lage im Osten veränderte sich bald gründlich und bot Handhaben zu einer Verbesserung der Stellung des Kurfürsten Schweden gegenüber. In Polen hatte sich eine von den Jesuiten geleitete katholisch-nationale Bewegung gegen die fremden Ketzer, die als Herren im Lande schalteten, erhoben. Der König war zurückgekehrt und hatte das Reich der Heiligen Jungfrau übergeben; der Adel huldigte ihm in leidenschaftlicher Überschwänglichkeit; überall eilte das Volk, von den Priestern geführt, zu den Waffen. Ein Frühjahrsfeldzug Karl Gustavs endete mit einem allgemeinen Rückzug der Schweden, und nun gewann die Bundesgenossenschaft des brandenburgischen Kurfürsten für ihn einen ganz anderen Wert als vorher. Er knüpfte neue Unterhandlungen an, um die Unterstützung der gesamten brandenburgischen Truppenmacht zu erhalten. Sie führten in dem Vertrag von Marienburg (25. Juni 1656) zu einem neuen Schutz- und Trutzbündnis zwischen Brandenburg und Schweden, bei dem der Kurfürst sich verpflichtete, dem Schwedenkönig auf ein Jahr mit seiner ganzen Macht und dann weiterhin mit 4.000 Mann beizustehen. Dafür sollte er einen Anteil an der Beute erhalten, wenn es zu einer Zertrümmerung und Aufteilung Polens kam, wie man sie damals in Aussicht nahm: vier polnische Palatinate, darunter Posen und Kalisch, sollten ihm zufallen; aber die Lehnsabhängigkeit von Schweden blieb bestehen. Sehr groß waren diese Vorteile nicht. Die vier polnischen Palatinate — abgesehen davon, dass man sie erst erobern und dann behaupten musste — waren ein Gebietszuwachs von zweifelhaftem Wert; sie schlossen sich zwar an die Mark Brandenburg an, aber sie schufen keine territoriale Verbindung mit Preußen. Immerhin war die Stellung des Kurfürsten dem Schwedenkönig gegenüber jetzt eine bessere.
Der Kampf begann nun sofort. Er drehte sich um die von den Polen soeben zurückeroberte Hauptstadt Warschau. Die Schweden und Brandenburger rückten mit vereinter Macht, 18.000 Mann stark, die Brandenburger etwa die Hälfte davon, gegen das 4 – 5 mal so starke polnische Heer heran, das zahlreichen Zuzug von Kosaken und Tataren erhalten hatte. Ein Vermittlungsversuch des französischen Gesandten, Marquis de Lumbres, der für die schwedisch brandenburgischen Verbündeten besorgt war, scheiterte an der Erbitterung und übermütigen Siegesgewissheit des Polenkönigs: er antwortete, wie erzählt wird, dem Marquis: die Schweden habe er den Tataren zum Frühstück geschenkt und den Kurfürsten wolle er in ein Loch stecken, wohin weder Sonne noch Mond scheine. So kam es zu der heißen, dreitägigen Schlacht von Warschau, 28. bis 30. Juli 1656, in der der Kurfürst von Brandenburg selbst neben dem Schwedenkönig das Kommando führte. Er wies namentlich an dem kritischen Tage, dem 29. Juli, während Karl Gustav seine Stellung wechselnd von einem Flügel auf den andern marschierte, so dass er selbst stundenlang den ganzen Druck der feindlichen Macht allein auszuhalten hatte, mit großer Kaltblütigkeit und Umsicht die wiederholten Sturmangriffe der Polen und Tataren auf seine Stellung zurück. Die nach schwedischem Muster geschulte brandenburgische Infanterie in ihren tief aufgestellten Gevierthaufen, die einem Tatarenaga wie „wandelnde Kastelle“ erschienen, und daneben die wirksam eingreifende Artillerie erwiesen sich dem Gegner überlegen. Am 30. Juli nahmen die Brandenburger unter dem Feldzeugmeister von Sparr in einem glänzenden Sturmangriff das Gehölz, das die Vorstadt Praga deckte; damit war der Sieg entschieden. Die feindliche Armee löste sich auf, und am 31. Juli hielt der Kurfürst an der Seite des Schwedenkönigs den Siegeseinzug in Warschau. Es war die erste Waffenprobe der neugebildeten brandenburgischen Armee. Sie hat sie glänzend bestanden. Sie trat seitdem der in aller Welt berühmten und gefürchteten schwedischen Kriegsmacht ebenbürtig zur Seite. Aber der strategische und politische Erfolg war gering. Zu einer nachhaltigen Verfolgung, die die Streitkräfte des Feindes aufgerieben hätte, ist es nicht gekommen. Eine völlige Vernichtung Polens lag doch nicht im Interesse des brandenburgischen Kurfürsten. Trotz der Waffenbrüderschaft blieb sein politisches Verhältnis zu dem Schwedenkönig von Argwohn und Misstrauen beherrscht. Er war vor allem bestrebt, Preußen zu decken, auf das sich der Angriff der bald wieder gesammelten und verstärkten polnischen Streitkräfte zunächst richtete. Am 8. Oktober erlitt Waldeck durch den polnischen General Gonsiewski eine Niederlage bei Protzko am Lyk, an der Südostgrenze von Preußen; das Herzogtum wurde von den polnisch-tatarischen Scharen überflutet, die bald auch Königsberg bedrohten. Durch das siegreiche Treffen bei Philippowo (22. Oktober) gelang es Waldeck, sie zurückzuwerfen und Preußen vorläufig zu sichern. Aber Karl Gustav war in desto größeren Nachteil geraten. Großpolen, Westpreußen, auch Danzig waren in die Hände der Polen gefallen; sie hatten die Seeküste gewonnen und die Schweden von der Verbindung mit den pommerschen Häfen abgeschnitten. Dazu kam ein allgemeiner Umschwung der politischen Lage, der ihnen günstig war. Der Zar Alexei von Russland, bisher ein Feind Polens, wandte sich jetzt gegen Schweden, dem er Livland zu entreißen suchte. Der Kaiser begann sich ebenfalls zugunsten Polens zu regen; der alte Hass gegen die vorwaltende protestantische Macht des Nordens hatte durch die Schlacht von Warschau neue Nahrung erhalten. Auch die Niederländer trafen Anstalten, ihren Ostseehandel gegen die Eingriffe der Schweden zu schützen. Im November stand Polen militärisch und politisch in einer sehr günstigen Stellung dazu; an die Eroberung der großpolnischen Palatinate, die man im Vertrage von Marienburg in Aussicht genommen hatte, war nicht mehr zu denken. Brandenburg musste durch andere Vorteile gewonnen werden, wenn es in der Verbindung mit Schweden festgehalten werden sollte; und in diesem Moment kam dem Schwedenkönig alles darauf an. So bewilligte er denn, so schwer ihm auch der Entschluss wurde, die vom Kurfürsten gestellte Bedingung: Verzicht auf die schwedische Lehnshoheit über Preußen, Anerkennung der Souveränität des Kurfürsten als Herzog von Preußen. Der Vertrag von Labiau vom 20. November 1656, der die Befreiung von dem schwedischen Joch brachte, war das persönliche Werk des Kurfürsten, der bei dem heftigen Streit der Meinungen unter seinen Räten, von denen die meisten für ein Abkommen mit Polen eintraten, während Waldeck unbedingt an Schweden festhalten wollte, und bei der gefährlichen Erbitterung der preußischen Stände doch ruhig und unbeirrt das Hauptinteresse seines Staates im Auge behielt. Er hat kurz vorher auch mit Polen unterhandelt und wäre wohl schon damals auf dessen Seite zurückgetreten, wenn Johann Kasimir bereit gewesen wäre, ihm die Souveränität zuzugestehen; aber davon war der Polenkönig damals weit entfernt, und so begnügte sich Friedrich Wilhelm zunächst mit der Abschüttelung der schwedischen Lehnshoheit — wahrscheinlich wohl schon in der Überzeugung, dass es sich dabei nur um eine vorläufige Regelung seines politischen Verhältnisses zu den beiden nordischen Mächten handle.
Ein neuer Feldzug in Polen, bei dem Waldeck die 4.000 Brandenburger kommandierte, die der Kurfürst nach dem Vertrage zu stellen hatte, verlief ähnlich wie die früheren. Anfangs drang das schwedisch-brandenburgische Heer siegreich vor; es vollzog in der Nähe von Sandomir im April die Vereinigung mit den Truppen, die der Fürst von Siebenbürgen, Georg Rakoczy, heranführte.
Die Kombination aus der Zeit Bethlen Gabors wiederholte sich. Umso enger schloss sich der Kaiser, dessen ungarische Interessen nun mit ins Spiel kamen, an die polnische Sache an. Sein Gesandter, Marquis von Lisola, machte dem brandenburgischen Kurfürsten Aussicht auf eine günstige Verständigung mit dem Kaiser und Polen und erhielt von ihm die Zusage, dass er sich rein defensiv verhalten und nicht wieder mit seiner ganzen Macht für die schwedische Sache eintreten werde.
Die vereinigten Feinde Polens hatten sich bald wieder getrennt und jeder verfuhr auf eigene Hand, sich auf seine Operationsbasis zurückziehend, während Johann Kasimir in kurzer Zeit sich wieder zum Herrn seines Reiches machte. Eine entscheidende Wendung aber erfolgte dann durch die Schilderhebung König Friedrichs III. von Dänemark gegen den jetzt in Bedrängnis geratenen alten Erbfeind Schweden. Karl Gustav entschloss sich, trotz der Abmahnungen seines Bundesgenossen, diesen Feind zuerst niederzuschlagen und verlangte von dem Kurfürsten in ziemlich rücksichtsloser Weise, das er inzwischen die Last des polnischen Krieges allein auf sich nehmen müsse. Das aber lag keineswegs im Interesse und in der Absicht Friedrich Wilhelms. Während die schwedischen Truppen durch Holstein und Schleswig gegen Jütland vorrückten, trat er in Verhandlungen mit Polen, wobei der kaiserliche Gesandte Lisola die Vermittlung übernahm. Dieser geschickte und eifrige Diplomat, dem sehr viel daran lag, den Kurfürsten für die bevorstehende Kaiserwahl (Kaiser Ferdinand III. war am 2. April 1657 gestorben) auf die habsburgische Seite zu ziehen, wandte alle mögliche Mühe an, um eine Verständigung mit Polen zustande zu bringen, wobei ihm auch der Einfluss der Frauen der kurfürstlichen Familie, der Mutter, der Gemahlin, der älteren Schwester Friedrich Wilhelms, zu Hilfe kam. Die Hauptbedingung für den Kurfürsten war die Bestätigung der preußischen Souveränität durch Polen; aber Johann Kasimir war nur sehr schwer zu diesem Zugeständnis zu bewegen. Noch im letzten Moment zog er die bereits gegebene Zusage wieder zurück, und die Unterhandlungen wären gescheitert, wenn nicht Lisola die Verantwortung dafür auf sich genommen hätte, die neue Instruktion zu ignorieren, bis der Abschluss erfolgt war. So ist es zu dem Vertrage von Wehlau gekommen, der am 19. September 1657 unterzeichnet wurde, auf brandenburgischer Seite durch Schwerin und Somnitz; die Ratifikation erfolgte erst nach einer persönlichen Zusammenkunft des Kurfürsten mit dem Polenkönig unter mancherlei ergänzenden Zusätzen in dem Vertrage von Bromberg vom 6.November 1657; die kluge und energische Gemahlin Johann Kasimirs, Luise Marie, eine französische Prinzessin aus dem Hause Nevers-Gonzaga, hat damals und auch weiterhin an der Herstellung eines besseren Verhältnisses zwischen den beiden Herrschern einen hervorragenden, entscheidenden Anteil genommen.
Die Hauptabsicht Brandenburgs, die Anerkennung der preußischen Souveränität durch Polen, war in dem Vertrage von Wehlau erreicht; allerdings musste der Kurfürst auf Ermland, das er dem schwedischen Bündnis verdankte, jetzt wieder verzichten. Dafür erhielt er aber in dem Bromberger Vertrag als eine — freilich nicht ganz gleichwertige — Entschädigung die an Hinterpommern angrenzenden Ämter Lauenburg und Bütow als polnische Lehen und die Starostei Draheim sowie die Stadt Elbing als freien Besitz, die letzteren allerdings unter einer Rückkaufsklausel. Gegen weitere Entschädigungen wurde von Brandenburg auch Waffenhilfe gegen Schweden mit einer Macht von 6.000 Mann zugesagt; doch war seine Beteiligung am Kriege noch nicht eine unmittelbare und notwendige Folge dieser Verträge, und es gelang zunächst dem Kurfürsten noch, einen offenen Bruch mit dem von dem dänischen Kriege ganz in Anspruch genommenen Schwedenkönig zu vermeiden, indem er sich den Anschein gab, als sei er einfach in seine alte Neutralitätsstellung zurückgekehrt; fast ein Jahr lang ist er nun in der Tat dem schleppend weitergeführten Kriege zwischen Schweden und Polen ferngeblieben, während Karl Gustav in einem glänzenden Winterfeldzuge, über die gefrorenen Belte marschierend, die Dänen niederwarf und sie zu dem schmählichen Frieden von Roeskilde zwang (Februar 1658), und während im Deutschen Reiche die Frage der Kaiserwahl, die alle anderen Interessen zurückdrängte, indem sie sich zugleich mit ihnen verband, auch für Brandenburg Anlass zu den lebhaftesten Unterhandlungen nach allen Seiten hin gab. Der Kurfürst schwankte nicht mehr zwischen den Parteien; er wusste, dass es mit Schweden zum Kampf kommen müsse und suchte durch näheren Anschluss an Österreich seine Position dazu so viel wie möglich zu stärken. Seine alten Forderungen — Jägerndorf oder Glogau und die Bezahlung der alten auf Schlesien fundierten Geldschuld —, die er auch jetzt anfangs wieder erhob, ließ er fallen, als er auf Schwierigkeiten stieß, und förderte auch ohne diese Zugeständnisse die Kaiserwahl Leopolds nach Möglichkeit. Am 1. Februar 1658 schloss er mit den österreichischen Gesandten, die nach Berlin gekommen waren (Lisola und Montecuccoli), einen Bündnisvertrag zu Schutz und Trutz gegen Schweden, in den auch Polen eingeschlossen war; die Hoffnung auf Eroberung des schwedischen Teils von Pommern lag seinen Kriegsplänen dabei schon zu Grunde. Erst am 28. Mai ist dieser Vertrag in Wien ratifiziert worden. Am 18. Juli 1658 fand dann die einhellige Kaiserwahl des 18 jährigen Habsburgers statt, um die sich Brandenburg in eifrigen und erfolgreichen Verhandlungen bemüht hatte. Kardinal Mazarin, der erst einen Moment lang an die Kandidatur seines Königs, Ludwigs XIV. gedacht, dann den Pfalzgrafen von Neuburg oder den Kurfürsten von Bayern begünstigt hatte, gab schließlich seinen Widerstand gegen die Wahl des Habsburgers auf und war nur noch bestrebt, in die Wahlkapitulation eine Bedingung hineinzubringen, die den Kaiser daran verhindern sollte, den Spaniern, die noch immer in den Niederlanden gegen Frankreich fochten und nahe daran waren, zu erliegen, durch österreichische Truppenhilfe Mut und Kraft zu längerem Widerstande zu geben. Um die Einhaltung dieser Bedingung und überhaupt die Interessen Frankreichs im Deutschen Reich zu sichern, hat er in sehr geschickter Benutzung der reichsständischen Assoziationsbestrebungen, deren Mittelpunkt namentlich der Kurfürst-Erzbischof von Mainz, Graf Johann Philipp von Schönborn war, den sogenannten Rheinbund zustande gebracht (14., 15. August 1658), der zu Anfang namentlich die drei geistlichen Kurfürsten, Kurpfalz, den Pfalzgrafen von Neuburg und Schweden umfasste und eine entschieden oppositionelle Haltung gegen den Kaiser einnahm — ein bereites Werkzeug der französischen Politik im Reiche. Der Kurfürst von Brandenburg hielt sich selbstverständlich von diesem Bunde fern, in dem seine Gegner, Pfalz Neuburg und Schweden, die Förderung ihrer Interessen fanden; er schloss sich umso enger an den Kaiser an, von dem er eine wirksame Unterstützung in dem bevorstehenden Kampfe mit Schweden erwartete. Der Anschein der Neutralität hatte sich Schweden gegenüber doch nicht auf die Dauer aufrechterhalten lassen. Im Juli bereits war es zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen gekommen, und der Kurfürst konnte jeden Moment auf einen Angriff Karl Gustavs gefasst sein. Von der Stimmung in diesen Tagen gibt eine Flugschrift Zeugnis, die wahrscheinlich aus der Feder Schwerins stammt und die den „ehrlichen Teutschen“, an den sie sich wendet, für den Krieg gegen Schweden und die Rückerwerbung Pommerns durch deutsche Hand zu erwärmen sucht, mit Tönen national-patriotischer Aufwallung, wie man sie in jenen Zeiten nur selten zu hören bekommt. Sie schildert den traurigen Zustand, in den Deutschland durch den Dreißigjährigen Krieg versetzt worden ist. „Wem sein Vaterland lieb ist“, „wem noch einiges teutsches Blut um sein Herze warm ist“, „muss darüber weinen und seufzen“. „Wir haben unser Gut, wir haben unser Blut, wir haben unsere Ehre und Namen dahin gegeben und nichts damit ausgerichtet, als das wir uns schier zu Dienstknechten und fremde Nationes berühmt, uns des hohen Namens fast verlustig und diejenige, so wir vorher kaum kannten, damit herrlich gemachet. Was sind Rhein, Weser, Elbe, Oder anders als fremder Nationen Gefangene? Was ist Deine Freiheit und Religion mehrs, als das andere damit spielen? summa: alles verlor sich mit dem herrlichen Pommern und mit anderen so stattlichen Ländern.“ Darum möge jeder bedenken, „was er für die Ehre des teutschen Namens zu tun habe, um sich gegen sein eigen Blut und sein, für allen Nationen dieser Welt berühmtes Vaterland nicht zu vergreifen.“ „Gedenke, dass du ein Teutscher bist!“
Man wird sich hüten müssen, national-politische Gesinnung, wie sie aus dieser Flugschrift spricht, als die eigentliche und dauernde Triebfeder der brandenburgischen Politik anzusehen. Ihre Richtung empfing die Politik des Kurfürsten in jedem Moment nur durch das Interesse seines Staates, aber ihre Farbe war damals, wo die Interessen des deutschen Namens und des Hauses Brandenburg zusammengingen, wirklich deutsch-national. Otto von Schwerin, in dem wir den Verfasser der Flugschrift vermuten dürfen, ein kluger, gebildeter, warmherziger pommerscher Edelmann, Geheimer Rat und Haushofmeister der Kurfürstin, vielleicht auch der Verfasser des der Kurfürstin zugeschriebenen Kirchenliedes „Jesus meine Zuversicht“ — nahm damals im Rate der Kurfürsten den ersten Platz ein, nachdem Waldeck, den sein starres schwedisches System seit der entschiedenen Wendung der brandenburgischen Politik unmöglich machte, den kurfürstlichen Dienst verlassen hatte. Eben in diesem Jahre 1658 (13. Oktober) ist Schwerin als Oberpräsident des Geheimen Rates und erster Minister vom Kurfürsten an die Spitze der Geschäfte gestellt worden.
Karl Gustav hatte im August den Krieg wieder eröffnet; aber statt, wie man erwartete, nach Preußen zu gehen, erschien er mit seiner Flotte am 17. August vor Kopenhagen, um erst dem dänischen Gegner, dessen Wiedererhebung er fürchtete, den Stoß ins Herz zu versetzen. Aber Kopenhagen, wo eine patriotische Bewegung der Bürgerschaft gegen den schwedischen Friedensbrecher der tapferen Politik des Königs Friedrich III. und seiner mutigen Gemahlin zu Hilfe kam, widerstand in erfolgreicher Verteidigung Woche auf Woche, und Karl Gustav begann in eine bedenkliche Lage zu geraten.
Diesen Moment ergriff der brandenburgische Kurfürst, um den Krieg gegen Schweden zu eröffnen. Im September rückte er an der Spitze einer Armee von 30.000 Mann, die aus brandenburgischen, kaiserlichen und polnischen Truppen zusammengesetzt war, vor und verdrängte die Schweden aus Holstein und Schleswig. Zugleich erschien eine holländische Flotte in See; sie erzwang die Durchfahrt durch den Sund, den die Schweden gesperrt hielten, brach die schwedische Blockade vor Kopenhagen und versorgte die Stadt, die sich tapfer zu verteidigen fortfuhr, mit den nötigen Lebensmitteln. Noch im Dezember gelang dann dem brandenburgischen Kurfürsten eine glänzende Kriegstat: unter Mitwirkung einiger dänischer Kriegsschiffe erstürmte er die von den Schweden tapfer verteidigte Insel Alsen. Im Frühjahr 1659 drang er nach Jütland vor. Fridericia, die letzte Position der Schweden auf dem Festlande, fiel im Mai in die Hände der Verbündeten. Nun wollte der Kurfürst nach den Inseln Fünen und Seeland hinübergehen, um Kopenhagen zu entsetzen. Aber da stieß er auf Schwierigkeiten, die er nicht zu überwinden vermocht hat. Er selbst hatte ja keine Flotte; die dänische war zu schwach, um den Widerstand der schwedischen zu brechen; die Holländer aber, die wohl über genügende Kräfte verfügt hätten, wurden durch diplomatische Einwirkungen von England und Frankreich zurück gehalten, die Schweden nicht gänzlich überwältigt sehen wollten. Im Mai 1659 hatten sich Frankreich, England und die Niederlande in dem Haager Konzert geeinigt, um durch diplomatische Intervention den Frieden zwischen Schweden und Dänemark auf Grund der Bedingungen von Roeskilde herzustellen. So misslangen denn die Versuche der Verbündeten, nach Fünen überzusetzen, im Juni und Juli; und der Kurfürst wandte sich nun, um seine eigenen Interessen wahrzunehmen, gegen Schwedisch-Pommern, das vom September 1659 ab der hauptsächlichste Kriegsschauplatz geworden ist, neben Westpreußen, wo die Polen erfolgreich gegen die schwedischen Stellungen vordrangen. Pommern war am Ende des Jahres (1659) bis auf Stralsund und Stettin von den Brandenburgern erobert, und der Kurfürst trug sich mit der Hoffnung, dass es ihm diesmal gelingen werde, den Schweden das Land zu entreißen. Die Hartnäckigkeit Karl Gustavs, der sich gegen einen Friedensschluss sträubte, machte es den Haager Verbündeten schwer, ihre Absicht zu erreichen. Selbst als die Holländer sich nun, um ihren Vermittlungsvorschlägen Nachdruck zu geben, dazu herbeiließen, das Unternehmen gegen Fünen tatkräftig zu unterstützen, als es im November 1659 in der blutigen Schlacht bei Nyborg zu einer völligen Niederlage der schwedischen Armee kam, selbst da gab Karl Gustav noch nicht nach, wenn er auch die Belagerung von Kopenhagen hatte aufheben müssen.
Eben damals erfuhr die europäische Gesamtlage eine eingreifende Veränderung durch den Abschluss des Pyrenäenfriedens, der dem langen Kriege zwischen Frankreich und Spanien ein Ende machte. Mazarin hatte nun die Hände frei und konnte wirksamer als bisher zum Schutze Schwedens eingreifen, das ja die Vormauer der französischen Interessen im Nordosten Europas war. Als Garant des Westfälischen Friedens erhob jetzt Frankreich Einspruch gegen die Eroberung von Vorpommern durch Brandenburg und forderte sofortige Rückgabe des Landes an Schweden. Eine französische Armee von 40.000 Mann wurde an den Grenzen zusammengezogen, um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen. Dies entschiedene Auftreten des französischen Ministers verfehlte seine Wirkung nicht. Die Verbündeten des Kurfürsten wurden abtrünnig. Die Polen waren zufrieden, ihr Land von den Schweden befreit zu haben, und der Kaiser hatte kein Interesse mehr an der Fortsetzung des Krieges, seit Spanien seinen Frieden mit Frankreich gemacht hatte; er war weit entfernt, für brandenburgische Interessen sich in eine kriegerische Verwicklung mit Frankreich einzulassen. Sobald die französische Forderung bekannt geworden war, gab er seinen Truppen, die an der Belagerung von Stettin teilnahmen, den Befehl zum Abzug. Der Kurfürst von Brandenburg war völlig isoliert. Seine Hoffnung, Schwedisch-Pommern behalten zu dürfen, war durch die französische Intervention vereitelt.
Mazarin war der Herr der Lage. Unter französischer Vermittlung fanden die Friedensverhandlungen statt, die seit 1659 in dem Kloster Oliva bei Danzig geführt wurden. Karl Gustav widerstrebte noch immer in alter Hartnäckigkeit einem Friedensschluss; er war nach Norwegen gezogen, dass er den Dänen zu entreißen suchte; dort aber ist er im Februar 1660 erkrankt und gestorben. Auch der Kurfürst von Brandenburg hat bis zuletzt die Vermittlungsvorschläge Frankreichs zurückgewiesen; aber er fand weder im Haag noch in Wien irgendwelche Unterstützung. In dem Frieden von Oliva (3. Mai 1660) musste er auf die vorpommerschen Lande Verzicht leisten. Er erlangte nur die Bestätigung der in den früheren Verträgen errungenen preußischen Souveränität und der von Polen abgetretenen Gebiete: Lauenburg, Bütow, Draheim. In den Besitz der Stadt Elbing, deren Abtretung auch wieder bestätigt wurde, hat er tatsächlich nicht zu gelangen vermocht. Die Stadt blieb in polnischen Händen; sie ist erst im Jahre 1700 tatsächlich ein Bestandteil des preußischen Staats geworden.
Der Friede von Oliva war in gewissem Sinne eine Enttäuschung für die weit ausgreifende Politik des brandenburgischen Kurfürsten; aber er bedeutete im Großen und Ganzen doch einen gewaltigen Fortschritt auf der Bahn zu einer selbständigen Machtstellung. Der Kurfürst selbst hatte eine großartige kriegerische und diplomatische Schule durchgemacht. Er hatte gelernt, sein politisches Interesse zur Richtschnur seiner Handlungen zu machen und hatte sich nicht gescheut, die Partei zu wechseln, wenn die Staatsräson es gebot. Er hatte dabei eine außerordentliche Geschicklichkeit bewiesen, einen zähen und elastischen Geist, wie er dem geborenen Politiker eigen ist; indem er das Ziel unverrückt im Auge behielt, verstand er es, in Mitteln und Wegen sich den Forderungen des Augenblicks anzupassen. Das Unsichere, schwankende seiner früheren politischen Haltung ist verschwunden. Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein haben sich in hohem Maße bei ihm entwickelt als das Resultat einer in großen Verhältnissen und im Ganzen doch auch mit entschiedenem Erfolg ausgeübten Tätigkeit. Seit dem Ausscheiden Waldecks hat keiner seiner Räte und GenerÄle mehr einen wirklich beherrschenden Einfluss auf seine Entschließungen besessen. Schwerin und andere, die wir seitdem in hervorragender Stellung finden, sind zwar auch noch Berater, aber nicht von so maßgebendem Gewicht wie früher Burgsdorff, Blumenthal, Waldeck gewesen waren. Der selbständige, autokratische Zug in dem Regiment des Kurfürsten tritt in schärferer Ausprägung hervor. Es bleibt noch immer seine Gewohnheit, die großen politischen Fragen wie die Angelegenheiten der Verwaltung mit seinen Geheimen Räten in förmlicher Sitzung zu erwägen; aber die Entscheidung gibt er nicht mehr, wie in den ersten Jahren seiner Regierung, gleich an Ort und Stelle und unter dem frischen Eindruck der Deliberation; sondern, nachdem er die Räte angehört und ihre Meinungen er wogen hat, überlegt er die Angelegenheit noch einmal für sich, lässt noch einen oder den andern zu sich kommen und trifft dann die Entscheidung in seinem Kabinett. Es ist eine ähnliche Regierungsweise, wie sie damals in Frankreich Ludwig XIV. ausgebildet hat. Sie erforderte einen anhaltenden und regelmäßigen Fleiß; der Kurfürst lebte beständig in den Geschäften. Nur die Jagd, die er mit Passion ausübte, unterbrach in Friedenszeiten diese regelmäßige Tätigkeit, die auch auf den häufigen Reisen in Königsberg oder Cleve fortgesetzt wurde. Auf diesen Reisen und im Kriege ließ sich der Kurfürst immer von einer Anzahl von Räten begleiten, die mit ihm die wichtigsten Angelegenheiten zu beraten hatten, während die in Cölln a. Spree zurückbleibenden Mitglieder des Geheimen Rates die laufende Verwaltung führten und ihm regelmäßige Berichte einsandten. In dieser rastlosen Regententätigkeit, in einem bewegten Reise- und Kriegsleben schloss sich die Summe seiner Kräfte zusammen zur Ausbildung einer achtunggebietenden Herrscherpersönlichkeit. Seine stattliche Erscheinung, die namentlich neben dem kurzen dicken Schwedenkönig Karl Gustav sehr vorteilhaft auffiel, das bedeutende Gesicht mit der Adlernase, dem energischen Kinn, den blitzenden blauen Augen, die ebenso zornig wie gütig blicken konnten, umrahmt von der Lockenfülle der großen Staatsperücke, gaben seinem Auftreten etwas Majestätisches; ein großer Zug in Haltung und Gebärde war ihm eigen. Aber im Grunde hatte seine cholerische Natur etwas Ungestümes, was ihn nicht selten im ersten Moment zu übereilten Worten und Handlungen fortriss. Die Ausbrüche seines Jähzorns waren gefürchtet. Wenn ihm das Blut zu Kopfe stieg und die Ader an der Stirn schwoll, dann pflegten nicht nur seine Diener, sondern auch die fremden Gesandten die gefährliche Nähe des Herrschers zu vermeiden. Aber, wie Friedrich der Große von ihm gesagt hat, wenn er nicht der ersten Regung Meister war, so war er es sicher der zweiten. Auf die hitzige Aufwallung folgte die kühle Besonnenheit, die der Staatsräson gehorchte; und die Leidenschaft setzte sich in eine starke Willensenergie und zähe Beharrlichkeit um. Eine tiefe Religiosität blieb die Grundlage seines persönlichen und politischen Lebens; die Regentenarbeit erschien dem strengen Calvinisten als ein Gottesdienst, der Erfolg als eine Gewähr für die göttliche Gnade. Durch einen reinen und aufrichtigen Wandel vor Gott glaubte er auch für die irdische Wohlfahrt seines Hauses und Staates am besten zu sorgen. Er war eine warme, vollblütige Natur; aber mit der ehelichen Treue nahm er es sehr genau. Das erste Kind seiner Ehe mit Luise Henriette ist bald wieder gestorben; erst 1665 und 1667 wurden zwei Söhne geboren, die am Leben blieben, Karl Emil und Friedrich, der spätere Thronfolger. Ihre Erziehung wurde durch Schwerin geleitet; der Kurfürst kümmerte sich aber auch selbst darum. Charakteristisch ist für seine Auffassung des Herrscherberufs das Wort, das er später einmal seinen Söhnen zum Auswendiglernen diktiert hat: sic gesturus sum principatum, ut rem populi esse sciam, non meam privatam. Es ist das Leitmotiv des aufgeklärten Absolutismus, das hier schon anklingt. Aber das Verantwortlichkeitsgefühl, das sich darin ausspricht, wurzelte bei Friedrich Wilhelm nicht in naturrechtlichen Anschauungen, sondern vielmehr durchaus in der religiösen Auffassung seines Fürstenamtes, und der patrimoniale Zug, der dem wirklichen Staatsleben der Zeit, ganz besonders in Deutschland, eigen war, behauptete daneben noch einen breiten Platz. Auch von dem brandenburgischen Kurfürsten könnte das Wort gelten, mit dem man die Regierungsweise Ludwigs XIV. gekennzeichnet hat: „I’Etat c’est moi“; nicht in dem Sinne, als ob das persönliche Interesse des Monarchen die Staatsräson bestimme, sondern in dem, dass beides untrennbar verbunden ist, das aus der Person des Fürsten der Staatsgedanke hervorwächst. Denn der große Kurfürst, wie er nun bald genannt wurde, ist in Wahrheit der Schöpfer eines Staates gewesen, dessen Idee lange Zeit hindurch nur in seinem Geiste lebte und erst sehr allmählich in der Wirklichkeit Gestalt gewonnen hat. Er war zu Anfang eigentlich noch nicht der Monarch eines großen Staates, sondern ein vielfacher Landesherr über ein Bündel von Territorien. Diese Ländermasse zu einem Staat zu machen, der sich in der Welt aufrechterhalten und für das Wohl seiner Angehörigen einstehen konnte, das ist recht eigentlich die Arbeit seines Lebens gewesen. Die Erwerbung der Souveränität in Preußen macht Epoche in diesen Bestrebungen zur Gründung eines modernen Staates. Unabhängig vom Reich, von Schweden, von Polen, nahm er hier eine ganz selbständige Stellung ein. Auch in den Reichslanden waren ja die wesentlichsten Attribute der Souveränität, Bündnis- und Kriegsrecht, durch den Westfälischen Frieden zu unbestrittener Geltung gelangt; aber die Zugehörigkeit zum Reichsverband, die Lehnsverpflichtung gegenüber dem Kaiser brachte doch immer noch eine keineswegs ganz belanglose politisch moralische Abhängigkeit mit sich. Wenn diese sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt verringert hat, wenn im Reiche die Stellung des hohenzollernschen Fürstentums allmählich immer freier und selbständiger geworden ist, so ist auch hier die Einwirkung der preußischen Souveränität nicht zu verkennen; die politische Gesamtstellung des Kurfürsten wurde maßgebend dadurch beeinflusst. Er gewann eine europäische Stellung. Und diese wirkte wieder auf das Machtverhältnis des Fürsten gegenüber den mitregierenden Landständen in den einzelnen Gebieten zurück. Wie er im Kampf mit diesen seinen Staat begründete, soll im nächsten Kapitel im Zusammenhange dargestellt werden.